Frau Hornberger, Sie sind Professorin für Didaktik der populären Musik an der Hochschule Osnabrück – was können Studierende bei Ihnen lernen?
Studierende können bei mir und bei uns – hoffentlich – lernen, dass Musik mehr ist als das Produzieren von Klang. Dass Musik eine Form von Kultur ist, eingewoben in kulturelle, historische, mediale, politische, soziale und ökonomische Prozesse. Dass gerade populäre Musik und mediale Inszenierungen untrennbar miteinander verbunden sind, dass Stars mediale Konstruktionen sind und Bühnenperformance mindestens so wichtig ist wie instrumentale Fertigkeiten.
Sie lernen hoffentlich auch, dass Menschen, die Kultur nutzen und gebrauchen, damit auch Prozesse von Teilhabe, von Identifikation, von Selbstermächtigung vollziehen. Und dass darum der Respekt von dem Publikum notwendig ist, wenn wir uns – theoretisch-analytisch oder künstlerisch-praktisch – mit Musik beschäftigen.
Am Institut für Musik (IfM) kann man sich für Musikerziehung einschreiben, aber keinen rein künstlerischen Studiengang wählen. Das heißt, die Schwerpunkte liegen auf der Lehre und Vermittlung und weniger auf der Ausbildung von Künstlerpersönlichkeiten?
Wir begreifen den Studiengang so, wie sein englischer Titel „Educating artist“ es beschreibt: als Schnittstelle von beidem. Wir bilden hervorragende Künstler*innen aus, die auch pädagogisch kompetent sind, bzw. Musikvermittler*innen mit hoher künstlerischer Exzellenz. Wir halten das nicht für einen Widerspruch, sondern sind davon überzeugt, dass die Fähigkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren und sich zu ihr ins Verhältnis zu setzen, das Pädagogische, das Wissenschaftliche und das Künstlerische, miteinander verbindet. Und wir glauben, dass mehr Wissen in allen drei Bereichen auch mehr Qualität in jedem einzelnen Bereich hervorbringt, und dass das ein zeitgemäßes Studium ist für Menschen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine sogenannte Portfolio-Karriere haben werden, also in unterschiedlichen Bereichen arbeiten.
Bei der Suche nach den Gründen für einen geringen Frauenanteil im Instrumentalbereich stellt sich ja immer die Frage, ob sie nicht wollen oder nicht können. Stellen Sie fest, dass die Bewerberinnen bei den Eignungsprüfungen schlechter abschneiden, weil ihnen vielleicht „popmusikalische“, also Band-Erfahrungen fehlen, sie z.B. im Spielen nach Leadsheets nicht so souverän sind wie die männlichen Bewerber?
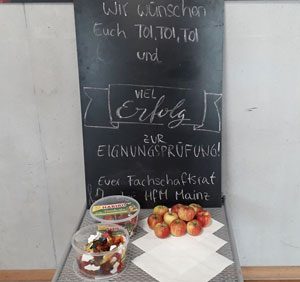 Wir scheitern, wie andere Studiengänge auch, meistens schon daran, dass sich nur wenige oder keine Frauen zur Eignungsprüfung anmelden. Im Gesang haben wir das Problem nicht, aber bei Schlagzeug, Bass und Gitarre gibt es einen eklatanten Gender-Gap bei den Bewerbungen. Und man kann die Frauen ja nicht zwingen. Wenn sie dann vorspielen, sind sie im Schnitt nicht schlechter als die männlichen Bewerber. Aber es fällt natürlich mehr auf: Wenn es auf ein Instrument nur eine Bewerberin gibt und die schafft die Prüfung nicht, dann hat man eben eine Ausfallquote von 100%. Wenn ein männlicher Bewerber es nicht schafft, gibt es noch 30 andere.
Wir scheitern, wie andere Studiengänge auch, meistens schon daran, dass sich nur wenige oder keine Frauen zur Eignungsprüfung anmelden. Im Gesang haben wir das Problem nicht, aber bei Schlagzeug, Bass und Gitarre gibt es einen eklatanten Gender-Gap bei den Bewerbungen. Und man kann die Frauen ja nicht zwingen. Wenn sie dann vorspielen, sind sie im Schnitt nicht schlechter als die männlichen Bewerber. Aber es fällt natürlich mehr auf: Wenn es auf ein Instrument nur eine Bewerberin gibt und die schafft die Prüfung nicht, dann hat man eben eine Ausfallquote von 100%. Wenn ein männlicher Bewerber es nicht schafft, gibt es noch 30 andere.
Dennoch: Es kann eine Rolle spielen, wie eine Prüfung gestaltet wird, welche Skills dabei für essentiell gehalten werden, ob und welche Form von Band-Erfahrung oder welcher Habitus vorausgesetzt wird. Da gibt es sicher sehr unterschiedliche Vorstellungen. Männliche Prüfer, deren Selbstbild und damit auch eine Vorstellung vom Beruf „Popmusiker“ eng an das Konzept Band gekoppelt ist, schätzen ein Defizit an dieser Stelle sicher bedeutender ein als jemand wie ich, die immer auch darauf schaut: Wie versteht jemand populäre Musik? Was hat er/sie eigentlich zu sagen? Ist das sein oder ihr Ausdrucksmittel? Welche kreativen Potentiale bringt die Person mit? Und – bei uns natürlich auch wichtig -: Ist die Person für einen pädagogischen Abschluss nicht nur offen, sondern auch geeignet?
 Wir versuchen unsere Kommissionen daher so zusammenzustellen, dass verschiedene Perspektiven vertreten sind. Meine Überzeugung ist außerdem, dass Eignungsprüfungen nicht nur dazu da sind, die „besten“ Studierenden zu finden – oft genug wäre ja strittig, was genau dieses „beste“ eigentlich ist. Ich suche vor allem das Match aus Person und Studienangebot: Mit wem wollen wir arbeiten? Und zu wem passt unser Studienangebot, wer wird bei uns „glücklich“? Und mit wem werden wir froh? Das sind Faktoren, die man nicht gut in Klausuren abprüfen, aber denen man sich in einem Gespräch zumindest nähern kann.
Wir versuchen unsere Kommissionen daher so zusammenzustellen, dass verschiedene Perspektiven vertreten sind. Meine Überzeugung ist außerdem, dass Eignungsprüfungen nicht nur dazu da sind, die „besten“ Studierenden zu finden – oft genug wäre ja strittig, was genau dieses „beste“ eigentlich ist. Ich suche vor allem das Match aus Person und Studienangebot: Mit wem wollen wir arbeiten? Und zu wem passt unser Studienangebot, wer wird bei uns „glücklich“? Und mit wem werden wir froh? Das sind Faktoren, die man nicht gut in Klausuren abprüfen, aber denen man sich in einem Gespräch zumindest nähern kann.
Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, warum so wenige junge Frauen sich für einen Instrumentalstudiengang entscheiden?

Typisches Role Model „Sängerin“: Ariana Grande (Foto: Wikipedia)
Die Gründe sind vielfältig und komplex und darum eben nicht wirklich leicht in den Griff zu bekommen. Um einige bekannte Gründe zu nennen: Es mangelt an guten Vorbildern und Role Models, die mit den Selbstkonzepten junger Frauen kompatibel sind. Die Lebensvorstellung „Musikerin sein“ schließt scheinbar, aber oft auch real, die Möglichkeit, Familie zu haben, aus. Noch immer sind Arbeitsverhältnisse in der Kultur prekär und ein Gender Pay Gap kommt noch dazu. Es kommt außerdem auch darauf an, welche Erfahrungen Jugendliche in Bands machen (bzw. ob sie solche Erfahrungen überhaupt machen) und ob sie daraus eine Vorstellung von einer beruflichen Existenz ableiten können. Die Einstellung der Eltern dürfte auch eine Rolle spielen.
Es gehört vor diesem Hintergrund schon einiges dazu, sich mit 18 oder auch 20 Jahren für so einen Weg zu entscheiden. Und ich verstehen auch Leute, die sich die Musik lieber als schönes Hobby erhalten wollen. Musik als Beruf zu haben, ist ja was anderes als nur seiner Leidenschaft nachzugehen.
Ein kleiner Diskurs: In meiner Jugendzeit gab es deutlich erkennbare „Gruppen“ und Styles, es gab Popper, Punks, Ökos, Grufties usw., man hörte bestimmte Bands, hatte einen bestimmten Kleidungs- und Lebensstil. Welche Musik man hörte, hatte einen hohen Stellenwert. Ist die Jugend heute „homogener“, vielleicht, weil die Bildgewalt unserer Medien und die Wucht, mit der sie den Jugendlichen vermitteln, was angesagt ist und was nicht, heute noch stärker wirken als früher? Ist die Musik heute weniger prägend für die eigene Entwicklung?
Ja, ich glaube, populäre Musik hat ihr vermeintliches Alleinstellungsmerkmal als Jugendkultur und Sozialisationsinstanz verloren. Populäre Musik wird inzwischen von allen Generationen und Milieus gehört, sie ist Alltagskultur, nicht mehr vorrangig Jugendkultur. An ihre Stelle sind für Jugendliche andere populäre Kulturen gerückt, insbesondere Serien und Games. Darüber tauschen sich Jugendliche aus, da entwickeln sie Leidenschaft, Kennerschaft und Involvement. Jugendliche verbringen auch mehr Zeit mit sozialen Medien und Plattformen wie Instagram, mit ihren Angeboten zur Selbstinszenierung, die es in den 1980er und 1990er Jahren so nicht gab.Ich bin aber nicht so pessimistisch, was die Heterogenität angeht: Serien und Games sind nicht so stark mit Dresscodes verbunden wie die Musikszenen. Daher ist eine Zugehörigkeit optisch nicht so sichtbar. Das heißt aber nicht, dass die Jugendlichen auch wirklich homogener sind.
In der Regel sind ja an den Hochschulen für Popularmusik ausschließlich Männer als Lehrpersonal in den Instrumental-Studiengängen zu finden; weibliche Dozenten gibt es meist nur im Gesang. Hochschul-Leitungen beklagen häufig, dass sich zu wenige Frauen bei ihnen bewerben würden. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Wenn die meisten Instrumentalmusiker Männer sind, ist es eine logische Folge, dass sich das im künstlerischen Personal an Hochschulen auch zeigt. Das ist bei uns nicht and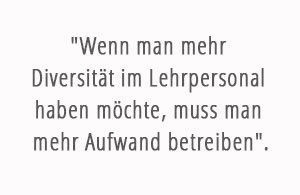 ers, auch wir haben eine große Dominanz von männlichen Kollegen. Aber wenn wir einen Lehrauftrag neu ausschreiben, versuchen wir erstens, Ausschreibungen sprachlich und inhaltlich so zu gestalten, dass Frauen sich eher angesprochen fühlen können – z.B. indem neben künstlerischer Exzellenz auch Teamfähigkeit gefragt ist. Und dann suchen wir Frauen, die wir gezielt zur Bewerbung auffordern. Dabei bitten wir auch unsere männlichen Kollegen um entsprechende Namen und Kontakte. Die kennen sich in ihren Fächern ja gut aus und viele von ihnen fördern Frauen sehr gern.
ers, auch wir haben eine große Dominanz von männlichen Kollegen. Aber wenn wir einen Lehrauftrag neu ausschreiben, versuchen wir erstens, Ausschreibungen sprachlich und inhaltlich so zu gestalten, dass Frauen sich eher angesprochen fühlen können – z.B. indem neben künstlerischer Exzellenz auch Teamfähigkeit gefragt ist. Und dann suchen wir Frauen, die wir gezielt zur Bewerbung auffordern. Dabei bitten wir auch unsere männlichen Kollegen um entsprechende Namen und Kontakte. Die kennen sich in ihren Fächern ja gut aus und viele von ihnen fördern Frauen sehr gern.

Christin Neddens ist Lehrbeauftragte für Schlagzeug in Osnabrück (Foto: Alex Bach)
Wenn sich dann Frauen bewerben, müssen sie sich natürlich im Verfahren durchsetzen, genau wie Männer auch, und natürlich kann es sein, dass dann dennoch ein Mann den Lehrauftrag bekommt. Aber oft bekommt ihn eben auch eine Frau, die man sonst gar nicht im Verfahren gehabt hätte. Wenn man diese Art von Diversität im Lehrpersonal haben möchte – und nicht nur Lippenbekenntnisse abgibt – muss man dafür ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Auf diese Weise konnten wir im letzten Jahr zwei Frauen gewinnen: eine für Schlagzeug und eine für Producing.
Es gibt ja sehr viele gut ausgebildete Jazzmusikerinnen, die sich als Dozentinnen für Instrumental-Studiengänge eignen würden. Was glauben Sie, sind die Gründe, dass diese dort nicht als Lehrende zu finden sind?
Es gibt mindestens zwei Gründe, die mir einfallen: Erstens: Es gibt eben nicht viele Instrumentalistinnen. Diejenigen, die sich einen Namen gemacht haben, die künstlerisch wirklich erfolgreich sind, sind meist so gut im Geschäft, dass sie das mit einer regelmäßigen Lehrtätigkeit zu den Konditionen einer Hochschule nicht mehr verbinden können oder wollen. Wir brauchen ja auch verlässliches Lehrpersonal, das wöchentlich unterrichten kann – und nicht nur schicke Namen auf der Website. Die fallen also wegen ihres Erfolges aus, die kann man eher mal für Workshops gewinnen.
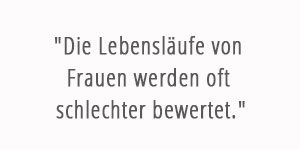 Zweitens: Viele Frauen sind sehr selbstkritisch, wenn sie Ausschreibungen lesen und glauben, dass sich eine Bewerbung nicht lohnt. Dem kann man entgegenwirken, in dem man sie konkret anspricht.
Zweitens: Viele Frauen sind sehr selbstkritisch, wenn sie Ausschreibungen lesen und glauben, dass sich eine Bewerbung nicht lohnt. Dem kann man entgegenwirken, in dem man sie konkret anspricht.
Drittens – und das ist nicht musikspezifisch: Menschen stellen oft Personen ein, die ihnen ähnlich sind und die Lebensläufe von Frauen werden oft schlechter bewertet. Dazu gibt es aussagekräftige Studien. Diese Art von Benachteiligung ist oft keine wirklich böse Absicht, Menschen folgen dann ihrem Gefühl, sie wollen, ja dass es am Ende „passt“. Man muss sich also fragen: Passt die Schlagzeugerin oder Gitarristin in ein rein männliches Team, mit lauter männlichen Studierenden? Ich würde sagen: Gerade da muss mehr Vielfalt rein! Aber andere sehen das vielleicht als Risiko.
Bei unseren Interviews mit Musik-Studentinnen kam häufig die Klage auf, dass sich ihre Instrumentallehrer ihnen gegenüber sehr ruppig verhalten und wenig supportiv agieren würden. Einige fühlten sich nicht respektiert und regelrecht erniedrigt, sie konnten das Verhalten ihrer Lehrer aber nicht einordnen, weil sie nicht wussten, ob es ihren männlichen Kommilitonen genauso ergeht. Über diese Probleme zu reden, scheint ein Tabu zu sein, weil keine*r sich eine Blöße geben will. Deckt sich das mit ihren Erfahrungen? Wie ließe sich von Seiten einer Hochschule angemessen darauf reagieren? Oder müssen Studierende diesen rauen Umgangston einfach in Kauf nehmen, wenn sie exzellente Musiker*innen werden wollen?
Hier kommen zwei Sachen zusammen: erstens die eher unrühmliche Tradition von „Meister und Schüler“ an Musik- und Kunsthochschulen, die Abhängigkeiten schafft und potentiell auch Missbrauch fördert. Mir ist es ein Rätsel, warum der Begriff des „Meisterkurses“ immer noch benutzt wird, ich würde immer von Workshops sprechen. Zweitens die Männerdominanz in der Pop-und Jazz-Szene, die sich an Musikhochschulen reproduziert.
 Ich höre das auch gelegentlich noch, der Ton in Bands „sei eben rau“, das müsse man eben aushalten. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht plausibel. Ein rauer Umgangston oder sexistische oder chauvinistische Verhaltensweisen sind ja keine notwendige Nebenfolge von musikalischer Qualität. Eine Band spielt ja nicht schlechter, wenn alle gut miteinander umgehen, vielleicht spielt sie sogar besser. Es könnte auch sein, dass der Ton konstruktiver und achtsamer wird, wenn Bands diverser sind, wenn sich alle mehr miteinander und umeinander bemühen müssen.
Ich höre das auch gelegentlich noch, der Ton in Bands „sei eben rau“, das müsse man eben aushalten. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht plausibel. Ein rauer Umgangston oder sexistische oder chauvinistische Verhaltensweisen sind ja keine notwendige Nebenfolge von musikalischer Qualität. Eine Band spielt ja nicht schlechter, wenn alle gut miteinander umgehen, vielleicht spielt sie sogar besser. Es könnte auch sein, dass der Ton konstruktiver und achtsamer wird, wenn Bands diverser sind, wenn sich alle mehr miteinander und umeinander bemühen müssen.
Wer so etwas sagt, will, so glaube ich, die eigenen Arbeits- und Sprechweisen nicht in Frage stellen und unbehelligt so weitermachen wie bisher. Heißt: Die eigene privilegierte Position nicht anerkennen und schon gar nicht zur Disposition stellen. Wer hingegen Frauen oder auch Persons of Color wirklich gleich behandeln oder sogar fördern will, muss seine eigenen Arbeitsweisen reflektieren und auch Platz machen.

Foto: Toolbox Gender und Diversity in der Lehre
Wenn Musiker so agieren, ist das ja schon unschön. Wenn sie aber als Lehrende so agieren, ist das noch viel problematischer. Lehrende sind gegenüber ihren Studierenden (die sie ja oft als Schüler und Schülerinnen bezeichnen), in einer Machtposition und müssen darum besonders rollensensibel sein. Wir am IfM sind da sehr konsequent: Wer seine Machtposition missbraucht und Grenzen nicht wahrt, kann bei uns nicht unterrichten. Wir ermutigen die Studierenden, problematische Vorgänge wahrzunehmen, Grenzüberschreitungen nicht zu dulden, sich zu wehren und mit uns auch darüber zu sprechen. Und mein Eindruck ist, dass Studierende tatsächlich selbst sensibler dafür werden und offener darüber sprechen und sowohl die Wahrung ihrer Grenzen als auch eine gender- und diversity-sensible Lehre einfordern.
Ich frage jetzt mal bewusst provozierend: Gibt es Ihrer Meinung nach geschlechtsspezifische Unterschiede in der Vermittlung von Musik? Setzen männliche und weibliche Lehrkräfte womöglich andere Schwerpunkte, stellen andere Ansprüche an die Studierenden, verhalten sich einer/einem Schüler*in gegenüber anders? Oder ist das mehr eine Frage von „alter Schule“ und modernem Unterricht?
Ich glaube, so einfach nach Männern und Frauen kann man das nicht aufteilen. Jede Lehrperson, auch ich, hat „blinde Flecken“, befindet sich in einer bestimmten Tradition und bringt auch den eigenen Charakter und die eigenen Vorbilder mit in das Geschehen ein. Ich habe vergleichsweise alte Männer erlebt, die Frauen engagiert fördern und jüngere Frauen, die grenzverletzend arbeiten. Darum erlaube ich mir hier kein pauschales Urteil.
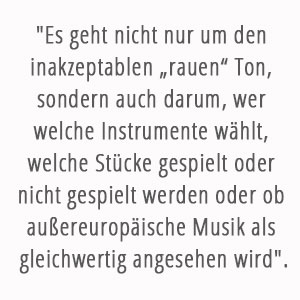 Auffällig ist generell im Kulturbereich, dass vermeintlich weibliche Genres und Vorlieben (nicht nur in der Musik) einen geringeren Status haben, dass der Kanon nicht nur in der Klassik, sondern auch im Pop männlich dominiert ist, dass über Künstler*innen, die von jungen Frauen besonders geschätzt werden, oft nur gelächelt wird. Das hat eine lange Tradition, die bis in die institutionellen Förderstrukturen von Wissenschaft und Kultur hinein reicht und die darum sehr wirkmächtig ist. Viele Lehrkräfte, Männer wie Frauen, hinterfragen diese Ordnungen nicht und unterrichten einfach, was sie kennen, sie reproduzieren das System, aus dem sie selbst stammen – ohne zu merken, dass sie damit Frauen systematisch marginalisieren.
Auffällig ist generell im Kulturbereich, dass vermeintlich weibliche Genres und Vorlieben (nicht nur in der Musik) einen geringeren Status haben, dass der Kanon nicht nur in der Klassik, sondern auch im Pop männlich dominiert ist, dass über Künstler*innen, die von jungen Frauen besonders geschätzt werden, oft nur gelächelt wird. Das hat eine lange Tradition, die bis in die institutionellen Förderstrukturen von Wissenschaft und Kultur hinein reicht und die darum sehr wirkmächtig ist. Viele Lehrkräfte, Männer wie Frauen, hinterfragen diese Ordnungen nicht und unterrichten einfach, was sie kennen, sie reproduzieren das System, aus dem sie selbst stammen – ohne zu merken, dass sie damit Frauen systematisch marginalisieren.
Ich möchte Educating Artists ausbilden, die gender- und diversitysensibel sind, was ihre eigene Kunst und was Vermittlung angeht. Wie Musik und Musikunterricht gedacht wird, das vermittelt sich ja oft schon in den Musikschulen. Wenn da anders ausgebildete Lehrende arbeiten, ist ein wichtiger Schritt getan. Und da geht es nicht nur um den inakzeptablen „rauen“ Ton, sondern auch darum, wer welche Instrumente wählt, welche Stücke gespielt oder nicht gespielt werden oder ob außereuropäische Musik als gleichwertig angesehen wird.
Was könnten Hochschulen verändern, um mehr junge Frauen* für ein Studium der Popularmusik zu begeistern?

Typisches Bild bei Hochschul-Bigbands (hier: HfMT HH & ETH Zürich)
Sie können faktisch gar nicht so viel tun, die maßgeblichen Entwicklungen finden ja vorher statt, in den Musikschulen, Schulen und am Übergang zu den Hochschulen. Und da müsste man sehr viel Zeit und Aufwand investieren, um substantiell etwas zu verbessern: Pre-Collages oder Schnupperstudium, enge Zusammenarbeit mit Schulen und Musikschulen, gezielte Vorbereitung von Frauen auf Eignungsprüfungen etc. Das alles erfordert aber so viel Zeit und Energie von allen Beteiligten, so viel Aufbau- und Netzwerkarbeit, das ist, das muss man klar sagen, neben dem ohnehin schon überfrachteten Tagesgeschäft aus Lehre, Forschung, akademischer Selbstverwaltung, Gutachten, Akkreditierungen etc. nicht zu machen. Dafür müssten eigene Stellen geschaffen werden, die das kompetent auf den Weg bringen und dafür verlässliche Strukturen herstellen. Und das heißt, dass die Landesregierungen als Mittelgeber der Hochschulen in der Verantwortung wären, dafür gezielt Stellen einzurichten; und da sehe ich keine einzige, die an dieser Stelle Frauenförderung zu ihrem Anliegen machen würde. Eigentlich gibt es hier eine doppelte Diskriminierung: Der Kulturbereich und die Frauenförderung sind ja beide typische Politikfelder für „Sonntagsreden“ – viel Bekenntnisse und relativ wenig konkrete Unterstützung.
 Aber für die Studentinnen, die da sind, können Hochschulen eine Menge tun. Sie können transparente und verlässliche Lehr-Strukturen schaffen, sie können dafür sorgen, dass Frauen sich sicher entwickeln können, sie können ermutigen und fördern und dazu beitragen, dass es weniger um „Männer gegen Frauen“, sondern um ein Miteinander geht. Das alles funktioniert vor allem, ganz schlicht, wenn die Hochschulen das selbst vorleben. Wenn es starke weibliche Professorinnen und Lehrkräfte gibt, wenn kollegial und grenzwahrend miteinander gearbeitet wird und wenn man sich sicher sein kann, dass man in einer Situation, in der man diskriminiert wird, Solidarität und Hilfe erfährt.
Aber für die Studentinnen, die da sind, können Hochschulen eine Menge tun. Sie können transparente und verlässliche Lehr-Strukturen schaffen, sie können dafür sorgen, dass Frauen sich sicher entwickeln können, sie können ermutigen und fördern und dazu beitragen, dass es weniger um „Männer gegen Frauen“, sondern um ein Miteinander geht. Das alles funktioniert vor allem, ganz schlicht, wenn die Hochschulen das selbst vorleben. Wenn es starke weibliche Professorinnen und Lehrkräfte gibt, wenn kollegial und grenzwahrend miteinander gearbeitet wird und wenn man sich sicher sein kann, dass man in einer Situation, in der man diskriminiert wird, Solidarität und Hilfe erfährt.
Sie haben ja auch einen Musikerinnen-Stammtisch initiiert. Wie wird dieses Angebot angenommen, gibt es viel Bedarf zum Austausch?
Der Stammtisch ist oft gar nicht soo voll, es passt ja zeitlich nicht immer allen. Aber er führt für die, die da sind, zu einem intensiven Austausch. Hier erzählen Frauen auch, was ihnen außerhalb des Studiums so auf Bühnen und bei Veranstaltungen passiert, wenn sie als Künstlerinnen unterwegs sind. Das sind oft haarsträubende Geschichten. Es ist sehr wichtig, dass die Studentinnen das erzählen, weil dann alle anderen auch merken: Das ist nicht mein privates Problem, es liegt nicht daran, dass ich eine schlechte Künstlerin bin, sondern: Das ist ein allgemeines strukturelles Problem. Daraus entsteht oft Wut, aber Wut ist ein besseres Gefühl als Verzagtheit.
Der Stammtisch ist wichtig, um sich unter Frauen frei austauschen zu können. Genauso wichtig ist aber der Austausch mit den männlichen Studierenden. Dafür probieren wir auch Formate aus, in denen wir im weitesten Sinne über Pop und Gesellschaft ins Gespräch kommen, z.B. auf der Grundlage von Texten oder Videos oder Dokumentationen. Da spielen alle möglichen Diskurse eine Rolle, auch die Frage von Gender und Musik. In diesen Formaten sind dann eben auch männliche Studenten involviert und das erweist sich als sehr produktiv. Denn meine Erfahrung ist, dass die männlichen Studierenden ein großes Interesse daran haben, mit den Kommilitoninnen gut und fair zusammenzuarbeiten. Darüber zu sprechen, was das konkret heißt oder warum das trotz guten Willens manchmal misslingt, hilft allen Beteiligten.

