
Barbara Schirmer (1981)
Ihre 40jährige musikalische Karriere begann Barbara Schirmer als Geigerin in der Gruppe „Schürmüli-Musig“, die mit ihrem Stück „Las Perlitas“ einen Radiohit landete und bis heute besteht. 1981 entdeckte sie schließlich ihre Liebe zu einem neuen Instrument, dem Hackbrett. Mit diesem reiste sie als Musikerin um die halbe Welt und realisierte im Laufe der Jahre unzählige interkulturelle Musikprojekte mit MusikerInnen aus vielen verschiedenen Ländern. Sie ist ein regelmäßiger Gast auf Folk- und Hackbrettfestivals, gibt Hackbrettunterricht und bietet Trommel-Workshops an. Aktuell ist sie mit Schürmüli Musig und ihrem Soloprogramm sowie mit Christian Zehnder im Duo Lausch unterwegs. Außerdem veranstaltet sie Heimatabende unter dem Titel „Nüüt und anders Züüg“ mit dem Schweizer Schriftsteller Andreas Neeser.
Liebe Barbara, kannst Du Dich an den Moment erinnern, als Du zum ersten Mal auf einem Hackbrett gespielt hast? Wie alt warst Du da?
Mein Vater spielte Hackbrett. Als Kind gefiel mir zwar der Klang sehr, doch spielte ich nicht damit, denn mein Instrument war die Violine. Wir machten Musik in der Familie und ich hatte immer großen Spaß dabei
Warst Du gleich Feuer und Flamme?
Als ich nach meinem Geografiestudium und einem Jahr Südamerika beschloss, mein Leben der Musik zu widmen, spürte ich sehr bald, dass das Hackbrett dabei eine wichtige Rolle einnehmen wird. Ich begann zu üben und ja: ich war vom ersten Moment an magisch angezogen!
Ich habe keine Vorstellung: ist es eigentlich schwer, das Hackbrett spielen zu erlernen? Du unterrichtest ja auch Kinder…
Jedes Instrument hat seine Schwierigkeiten. Beim Hackbrett ist der schöne Klang sehr einladend und jeder kann bald Melodien spielen. Die Schwierigkeiten zeigen sich erst mit fortschreitendem Spiel.
 Begonnen hat Deine Musikkarriere mit der Gruppe „Schürmüli Musig“, in der Du mit Deinen Eltern und weiteren Musikern gespielt hast. Wie muss man sich das vorstellen, eine Art kleine „Kelly Family“?
Begonnen hat Deine Musikkarriere mit der Gruppe „Schürmüli Musig“, in der Du mit Deinen Eltern und weiteren Musikern gespielt hast. Wie muss man sich das vorstellen, eine Art kleine „Kelly Family“?
Als ich nach meiner Südamerika-Reise nach Hause kam, hatte ich kein Geld mehr. Es war Winter und ich wäre trotzdem gerne Skilaufen gegangen. Ein Freund schlug vor: „Lass uns mit den Instrumenten auf die Skipiste gehen und für die Skifahrenden spielen“. Wir fuhren alle sehr gut Ski und es war einfach toll, mit den Instrumenten die Hänge runterzusausen, einen Stopp zu machen und live „Pistenmusik“ zu machen.

Schirmer (3. v. r.) mit Schürmüli Musig (1990)
Man stelle sich das Mitte 70er Jahre mal vor, da gab es noch keine Pistenunterhaltung! Das schlug ein wie eine Bombe und wir wurden gleich fürs größte Folkfestival der Schweiz eingeladen. Da wir noch keinen Namen hatten, fragten uns die Veranstalter, wo wir wohnen. Wir sagten: „in der Schürmühle“. Also war die „Schürmüli Musig“ geboren. Wir spielten zuerst in verschiedenen Formationen: wenn meine Eltern noch dabei waren, hießen wir „Schürmüli Musig mit de Alte“. Doch das Zwei-Generationen-Spiel machte auch meinen Freunden Spaß, so dass wir bald als „Schürmüli Musig“ nur noch zusammen mit meinen Eltern spielten.
Hattest Du auch weibliche Vorbilder?

Schirmer (li) auf der 1. Schweizer Frauenmusikwoche (1983)
Als Hackbrettspielerin nicht, da in der Schweiz das Hackbrettspiel zu jener Zeit eine reine Männerdomäne war. Doch neben der Schürmüli Musig wollte ich unbedingt mit anderen Frauen Musik machen. Ich lernte bald tolle Musikerinnen kennen: die Feminist Improvising Group mit Irène Schweizer, Maggie Nicols, Joëlle Léandre, etc. liebte ich heiß. Ich wurde sogar auf einer Tour ihre Tontechnikerin und lernte enorm viel über Improvisation. Ich gründete meine eigenen Frauenbands, begann selber Stücke zu schreiben und entwickelte meinen eigenen Stil. Von Anfang an war ich im Vorstand bei „Frauen machen Musik“, ein wilder Verein, der bereits Anfangs der 80er Jahre z.B. die legendären Schweizer Frauenmusik Wochen organisierte.
Das Hackbrett sieht man hierzulande recht selten, es ist vor allem in der alpenländischen Volksmusik bekannt. Welchen Stellenwert hatte das Instrument, als Du es erlernt hast? Es war ja anscheinend nicht „normal“ für eine junge Frau, es zu spielen?
Nein, absolut „nicht normal“! Wobei interessant ist, dass in der Schweiz im 16/17 Jhdt. das Hackbrett sehr wohl auch von Frauen gespielt wurde, es gibt schriftliche Zeugnisse. Aber als es durch die Erfindung des Klaviers in die Bergregionen zurückgedrängt wurde, hatten wohl die Bergbäuerinnen schlicht und einfach keine Zeit und die Männer – wie so oft – machten sich das Instrument zu eigen.
Wie ist es heute: hast Du viele junge SchülerInnen, die das Instrument erlernen wollen?
In den letzten zwanzig Jahren hat sich enorm viel geändert – die Pionierarbeit von mir und meinen Musikerkolleginnen und Kollegen hat sich gelohnt – zur Zeit boomt das Hackbrett bei den Kindern und sowohl Mädchen wie Knaben wollen das Instrument spielen lernen.
Du spielst zwar ein traditionsreiches Instrument, hast aber schon früh andere Musikkulturen in Dein Spiel einfließen lassen. Zum Beispiel hast Du schon in den 80ern in der Gruppe Schürmüli Musik mit dem Hackbrett südamerikanische Rhythmen gespielt. War das dem einjährigen Aufenthalt in Südamerika geschuldet? Warst Du dort als Musikerin unterwegs?
Ja, wie gesagt, die Südamerika-Reise hat meine Liebe zur Musik endgültig geweckt. Ich hatte die ganze Zeit die Violine bei mir und machte viel Musik. Zwar war ich als Geografin unterwegs, doch „mutierte“ ich, ohne dass ich es bewusst merkte, zur Musikerin.
Du bist auch viel in der Welt unterwegs, spielst auf Festivals z.B. in Südamerika, Iran oder Südkorea. Wie nimmst Du die „fremden“ Eindrücke auf, sammelst Du systematisch die Klänge und Rhythmen und versuchst sie dann auf Deinem eigenen Instrument umzusetzen?
Ich lasse mich auf ganz verschiedene Art und Weise inspirieren – vor allem durchs Zuhören. Musik machen ist in erster Linie ZUHÖREN.
 Du hast ja eine ganz neue Spieltechnik für das Hackbrett entwickelt, ausgehend von der Vibraphontechnik. Das hat Dir den Titel „die Hackbrett-Revolutionärin“ (FAZ) eingebracht. Wie kam es dazu?
Du hast ja eine ganz neue Spieltechnik für das Hackbrett entwickelt, ausgehend von der Vibraphontechnik. Das hat Dir den Titel „die Hackbrett-Revolutionärin“ (FAZ) eingebracht. Wie kam es dazu?
Ein Hackbrettbauer entwickelte in den 80er Jahren einen ganz neuen Hackbrett-Typus. Neu sowohl in der Bauweise wie auch in der Tonanordnung mit genialen neuen Ideen. Da es damals in der Schweiz noch keine Hackbrettlehrer gab, genoss ich eine ausgezeichnete Weiterbildung bei einer Vibraphonistin. Sie war es, die mich ermunterte, das große neue Hackbrett mal mit vier anstatt mit zwei Klöppeln zu spielen. Ich war total fasziniert von dieser Idee und begann mit einer Forschungsarbeit, die mich wohl bis an mein Lebensende ausfüllen wird. Die erste Aufgabe war, geeignete Sticks für das 4-Stick-Spiel entwickeln zu lassen. Diese Arbeit musste sehr systematisch angegangen werden. Bezüglich Länge, Material des Schaftes, Material des Stick-Kopfes, Elastizität etc. konnten wir jeweils nur eine Komponente aufs Mal ändern, um ein eindeutiges Resultat zu erhalten. Die Sticks, die ich zurzeit verwende, sehen völlig lapidar aus, sind jedoch das Resultat einer langjährigen Entwicklung. Die Suche nach geeigneten Sticks hatte einen sehr innovativen Nebeneffekt: ich experimentierte mit ganz verschiedene Sticks auf dem Instrument und entdeckte so völlig neue Klänge. Diese Klangerweiterungen wiederum brachten mich auf die Idee, das Hackbrett auch mit andern Gerätschaften zu spielen, es z.B. mit einem Bogen zu streichen, mit Gläsern wie auf einer Gitarre zu sliden etc. Die zweite Aufgabe bestand darin, Kompositionen für die 4-Stick-Technik zu finden. Ich suchte zuerst im Mallet Bereich, auch bei Gitarren- und Klavierstücken etc., merkte jedoch bald, dass die sehr spezielle Anordnung des Hackbrettes und sein ganz eigener Klang mit seinen Obertonstrukturen andere Voicings und Klangverbindungen erfordert. So begann ich selbst für dieses Instrument zu komponieren und merkte bald, wie viel Spaß mir das Komponieren macht. Obschon es ja wohl die brotloseste Kunst ist (außer frau produziert einen Hit), fasziniert mich diese Arbeit bis heute außerordentlich und es freut mich, dass meine Kompositionen immer mehr Leute und auch Fachleute begeistern.

Lausch
Du hast die verschiedensten Musik-Projekte gemacht, das bekannteste Projekt ist aber wahrscheinlich Dein Duo Lausch mit Christian Zehnder, wo Ihr eine ganz eigene, neue alpine Musik entwickelt habt. Was reizt Dich daran?
Wie gesagt bin ich Appenzellerin, also eine Berglerin, ich wohne jedoch im Aargauischen Hügelland und meine Wurzeln, die Berge, sind eine Sehnsucht. Aus diesem Spannungsfeld einer Migrantin schöpfe ich für meine Musik Melancholie, Freude, Abgründe, Reibungen, wilde Lust. Ein ähnliches Schicksal hat auch Christian Zehnder und so ist es u.a. wohl diese Entwurzelung, die uns antreibt und uns musikalisch verbindet.
Wenn man ein Konzert von Euch sieht und hört, kann man meditativ-kontemplativ abtauchen, es ist eine regelrechte Magie, der man sich nicht entziehen mag. Wie sieht Eure Zusammenarbeit aus? Entsteht viel durch Improvisation?
Ja, es ist meist so, dass einer von uns eine Idee, ein Themenfragment, einen Rhythmus, eine Akkordfolge bringt und dann spielen wir improvisierend mit diesen Bruchstücken bis sich eine Architektur, eine Geschichte entwickelt, die wir dann mit Noten notieren, uns aber Freiräume offen lassen.
 Jetzt aber zu Deiner neuen CD „Falter“, Deinem ersten Soloalbum, das im letzten Herbst erschienen ist. Was hat Dich zu dem Titel inspiriert?
Jetzt aber zu Deiner neuen CD „Falter“, Deinem ersten Soloalbum, das im letzten Herbst erschienen ist. Was hat Dich zu dem Titel inspiriert?
Ich mag das Zerbrechliche, das Geheimnisvolle dieses Wesens sehr. Oft erzähle ich dem Publikum die Geschichte, wenn ich nachts nach einem Konzert nach Hause komme: Es ist dunkel. Ich höre was… was ist es? Ich mache Licht… oh, es ist ein Falter… ich höre ihn… ich höre ihn nicht… wo ist er nun? … Ach nein, jetzt ist er in der Lampe! Und im Wort FALTER steckt auch das Wort ALTER und FALTE und ENTFALTUNG. Ich mag solche reichen Wörter sehr.
Du hast das Album komplett in Eigenregie in drei Wochen bei Dir zuhause aufgenommen. Jetzt wurde es für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert und bekommt vielleicht ein Gütesiegel, das es zu eine der „besten und interessantesten Neuveröffentlichungen der vorangegangenen drei Monate“ auszeichnet (die Bestenliste wird am 15.02. bekannt gegeben). Was bedeutet Dir die mögliche Auszeichnung?
Also zuerst bin ich einfach stolz, dass ich diese CD in vierfacher Person (Komponistin, Musikerin, Tontechnikerin, Produzentin) mit einfachsten Mitteln in dieser Qualität hingekriegt habe. Ich hatte zuvor immer Horror vor Studioarbeit, da es für mich mit einem Instrument, das die Hälfte der teuren Studiozeit immer mit Stimmen verschlingt, stets Stress pur ist. Nun war ich ja bei mir zuhause in meinem wundervollen Atelier in der Schürmühle; ich arbeitete zwar gratis, hatte aber auch keine hohen Studiokosten im Nacken. Das machte mich sehr kreativ und war zwar auch eine riesige Herausforderung, aber gleichzeitig großes Vergnügen. Die Nomination kam sehr überraschend für mich, ich hatte mich überhaupt nicht beworben, sendete ein paar CDs an FreundInnen von mir in Deutschland, und vermutlich hat ein deutscher Journalist diese CD der Jury weitergeleitet. Wenn ich auf der Website des Preises der Deutschen Schallplattenkritik all die berühmten Namen von Musikerinnen und Musikern und die großen Labels lese, ist für mich die Nomination an sich schon ein Gütesiegel, das mich sehr freut.
In Deiner Komposition „A1 Aarau West – Aarau Ost“ zeigst Du die verschiedenen Facetten, die eine Autobahnfahrt haben kann, die Stimmungen wechseln rasant. Ist das eine typische Arbeitsweise von Dir, dass Du Stimmungen aufgreifst und versuchst, sie musikalisch umzusetzen oder wie entstehen Deine Stücke?
Wie gesagt entsteht meine Musik durch tiefes Hineinhören in meine Migrantenpersönlichkeit (zu meinen Vorfahren väterlicherseits gehören auch Romas). Das innere und äußere Unterwegssein ist Teil meines Lebensexiliers. Ich liebe es, Grenzen zu überqueren, anderen Musikkulturen zu begegnen, aufzusaugen, was mir möglich ist. Ich liebe es aber auch, genau hinzuhören, um Raum für Überraschendes zu öffnen und mit meiner Musik das Sensorium jenseits der Gewohnheiten zu berühren.
Wie hat sich das angefühlt, alles – neben Hackbrett kommen Kuhhorn, Kalebasse, Quinto, Tumba, Surdo, Shaker, sowie Stimme zum Einsatz – ohne Band einzuspielen? War das Soloalbum ein lang gehegter Traum von Dir?
Das Soloalbum entstand völlig spontan. Ich wollte zunächst nur zwei, drei Stücke aufnehmen, damit ich nicht nur die Noten als Gedächtnisstütze habe, sondern auch die Umsetzung in Livemusik. Doch dann kam immer noch ein Stück dazu, bis ich merkte: das wird eine CD! Ich schöpfte das köstliche „Sommerloch“ voll aus, mich drei Wochen lang ganz in diese Arbeit zu vertiefen und entwickelte neue Arrangements, die mir das Mehrspurverfahren einer CD Produktion ermöglichte. So kamen auch Perkussioninstrumente dazu. Das Trommeln ist für mich schon lange die rhythmische Grundlage für das Hackbrett, das ja auch ein wunderbares Perkussioninstrument ist, das darüber hinaus alle Töne zur Verfügung hat.
Lässt es sich als Profimusikerin in diesem Genre in der Schweiz gut davon leben?
Vom materiellen Standpunkt her gehört frau-Musikerin (außer sie landet einen Hit) zur unteren Einkommensstufe ohne Pensionskasse und andere Annehmlichkeiten etc. Ein ewiger Kampf… Ich werde darüber noch mal ein Buch schreiben… sehr interessant auch vom soziologischen Standpunkt aus! Vom immateriellen Standpunkt her finde ich, habe ich sehr viel Luxus: ich kann das machen, was ich am meisten liebe. Ich bin meine eigene Chefin und ich verbessere mich auch als Chefin noch stetig, erlaube mir Freiräume, Erholungsinseln, damit ich wieder Höchstleistungen erbringen kann. Das empfinde ich als ungeheures Privileg. Und es ist für mich auch faszinierend, mich immer wieder, Monat für Monat, in dieser überversicherten Schweiz, der Unsicherheit auszusetzen. Ich weiß, dass ich auf diese Art und Weise nur in einem sehr reichen Land leben kann. Aber meine vielen Auslandreisen haben mir gezeigt, dass es Kulturschaffende auch in ärmeren Ländern immer wieder mit einer ungeheuren Innovationskraft schaffen, sich eine Existenz aufzubauen.
Wie reagiert das heimische Publikum auf Deine/Eure neue alpine Volksmusik?
Unterschiedlich – göttinseidank! Die vorwiegend männliche Hackbrettszene ignoriert mich größtenteils, stempelt mich als seltsamen Vogel ab, der in keine Schublade passt. Dann das Phänomen der Prophetin im eigenen Land kenne ich auch, oder unterschwelligen Neid, z.B. eine 66jährige Frau auf der Bühne: „So was von unsexy, da himmle ich lieber einen alten männlichen Knacker an…!“ Was mich hingegen fasziniert, ist, wenn ich mit meiner Musik Leute erreiche, die zuvor nie gedacht hätten, dass ihnen nun ausgerechnet diese Stücke gefallen. Und klar gibt es viel, viel Zuspruch und tolle differenzierte Feedbacks. Vielen Dank!

Ab März mit Carlo Niederhauser auf FALTER-Tour
Wie sind Deine Pläne für 2018?
Ich freue mich enorm, nun ab März mein FALTER Programm in einer lustvollen Live Version zum Publikum zu bringen. Ich habe für die Live-Konzerte den sehr vielseitigen Cellisten, Carlo Niederhauser, als Duo-Partner gewinnen können. Zusammen entwickeln wir aus meinen Kompositionen einen spannenden Dialog, überspringen mit Leichtigkeit stilistische Grenzen und hören in Freiräume hinein, so dass jedes Konzert eine einmalige Geschichte erzählt. Dann habe ich eine Anzahl anderer Projekte, die weiterentwickelt werden wollen (mehr dazu auf ihrer Homepage). Und – last but noch least – freue ich mich auf alles Unterwartete, das an mich herangetragen wird!
Vielen Dank für das Gespräch!
Termine:
CD-Release Tour „Falter“ mit Carlo Niederhauser, Cello
09.03. Bern, Alpines Museum
21.03. Zürich, Kapelle im Klus Park
Und diverse Hauskonzerte mit Anmeldung, s. https://www.hackbrett.com/agenda
Schürmüli Musig
21.01. Henggart Zwirbelistubete, Saal 18:30 Uhr
18.02. Zürich, Volkshaus Tanz um 17:00 Uhr
Nüüt und anders Züüg
25.02. Reitnau, 17:00 Uhr
20.03. Riehen BL, Kellertheater im Haus der Vereine 20:00 Uhr
03.06. Leuggern, Schloss Hettenschwil 11:00 Uhr
Lausch
01.02. Luzern, Kleintheater
04.02. Küsnacht, Seehof
Die CD „Falter“ ist hier erhältlich.
Infos


 Dass Akhondy ihre Heimat verließ, hat ihr zu großer künstlerischer Freiheit verholfen, die sie in Ensembles wie der Band Paaz nutzt oder dem Chor Banu, der wahrscheinlich einzigen iranischen Frauen-A Capella Gruppe weltweit. Bis zu 25 Sängerinnen zwischen 25-65 Jahren kommen donnerstags zur Probe, aber bei Konzerten stehen meist nur 7 von ihnen auf der Bühne. Eine Unmöglichkeit in ihrer Heimat, denn Frauen ist dort das öffentliche Musizieren und Singen nur ganz eingeschränkt möglich: vor weiblichem Publikum dürfen sie solistisch öffentlich auftreten, vor gemischtem Publikum aber nur, wenn ihr Gesang von männlichen Gesangsstimmen überdeckt wird. Wie sie die Islamische Revolution und den Umzug nach Deutschland erlebt hat und was ihren Chor so besonders macht, erzählt sie uns in folgendem Interview.
Dass Akhondy ihre Heimat verließ, hat ihr zu großer künstlerischer Freiheit verholfen, die sie in Ensembles wie der Band Paaz nutzt oder dem Chor Banu, der wahrscheinlich einzigen iranischen Frauen-A Capella Gruppe weltweit. Bis zu 25 Sängerinnen zwischen 25-65 Jahren kommen donnerstags zur Probe, aber bei Konzerten stehen meist nur 7 von ihnen auf der Bühne. Eine Unmöglichkeit in ihrer Heimat, denn Frauen ist dort das öffentliche Musizieren und Singen nur ganz eingeschränkt möglich: vor weiblichem Publikum dürfen sie solistisch öffentlich auftreten, vor gemischtem Publikum aber nur, wenn ihr Gesang von männlichen Gesangsstimmen überdeckt wird. Wie sie die Islamische Revolution und den Umzug nach Deutschland erlebt hat und was ihren Chor so besonders macht, erzählt sie uns in folgendem Interview. Das war kurz vor dem Jahr 2000. Da bekam ich Lust, mehr über die Volksmusik meiner iranischen Heimat zu erfahren. Weil ich ja aus der traditionellen persischen Kunstmusik komme, die man vom Anspruch her vielleicht mit der klassischen europäischen Musik vergleichen könnte, wusste ich gar nicht soviel über die Volksmusik Irans. Mit einigen meiner in Köln lebenden iranischen Gesangsschülerinnen gründete ich deshalb einen kleinen Chor, der vorerst nur aus sieben Frauen und mir bestand. Reizvoll war daran auch, dass wir keine zusätzlichen Musiker brauchten – Klanghölzer und Rahmentrommeln reichten völlig aus, um unseren Gesang selbst zu begleiten.
Das war kurz vor dem Jahr 2000. Da bekam ich Lust, mehr über die Volksmusik meiner iranischen Heimat zu erfahren. Weil ich ja aus der traditionellen persischen Kunstmusik komme, die man vom Anspruch her vielleicht mit der klassischen europäischen Musik vergleichen könnte, wusste ich gar nicht soviel über die Volksmusik Irans. Mit einigen meiner in Köln lebenden iranischen Gesangsschülerinnen gründete ich deshalb einen kleinen Chor, der vorerst nur aus sieben Frauen und mir bestand. Reizvoll war daran auch, dass wir keine zusätzlichen Musiker brauchten – Klanghölzer und Rahmentrommeln reichten völlig aus, um unseren Gesang selbst zu begleiten. Es ist das Eintauchen in ein weiteres mit dem Iran verbundenes Genre und noch einmal etwas wesentlich Anderes als der Schritt, den ich seinerzeit von der klassischen persischen Kunstmusik meines Ensembles Barbad hin zu den mit meinem Frauenchor Banu gesungenen Volksliedern machte. Natürlich geht es auch um schöne Erinnerungen an meine Jugend. Die meisten der Paaz-Stücke entstanden ja in den 1950er bis 1970er Jahren, in denen sich viele iranische Komponisten von populärer europäischer Musik inspirieren ließen.
Es ist das Eintauchen in ein weiteres mit dem Iran verbundenes Genre und noch einmal etwas wesentlich Anderes als der Schritt, den ich seinerzeit von der klassischen persischen Kunstmusik meines Ensembles Barbad hin zu den mit meinem Frauenchor Banu gesungenen Volksliedern machte. Natürlich geht es auch um schöne Erinnerungen an meine Jugend. Die meisten der Paaz-Stücke entstanden ja in den 1950er bis 1970er Jahren, in denen sich viele iranische Komponisten von populärer europäischer Musik inspirieren ließen. Wenn es möglich ist, reise ich einmal im Jahr in den Iran, treffe mich dort mit alten Kolleginnen und Kollegen oder bummele in Teheran durch den Stadtteil Baharestan, in dem es besonders viele Instrumentenbauer und Musikgeschäfte gibt. Eigentlich hätte ich in diesem Jahr erstmals eine Studienreise zu den Musikkulturen Irans begleiten sollen. Dabei wäre es möglich gewesen, weitere Kontakte zu Musikern in fast allen Landesteilen zu knüpfen. Das ging natürlich wegen Corona nicht. Meine letzte Begegnung mit im Iran lebenden Musikern hatte ich deshalb beim Rudolstadt Festival 2019, bei dem Iran der Länderschwerpunkt war und zu dem auch ich mit Banu eingeladen war. An den Kolleginnen und Kollegen im Iran bewundere ich sehr, mit welcher Ausdauer und Energie sie es schaffen, sich immer wieder neu auf sich häufig verändernde Regeln einzustellen und ihre künstlerische Arbeit fortzuführen.
Wenn es möglich ist, reise ich einmal im Jahr in den Iran, treffe mich dort mit alten Kolleginnen und Kollegen oder bummele in Teheran durch den Stadtteil Baharestan, in dem es besonders viele Instrumentenbauer und Musikgeschäfte gibt. Eigentlich hätte ich in diesem Jahr erstmals eine Studienreise zu den Musikkulturen Irans begleiten sollen. Dabei wäre es möglich gewesen, weitere Kontakte zu Musikern in fast allen Landesteilen zu knüpfen. Das ging natürlich wegen Corona nicht. Meine letzte Begegnung mit im Iran lebenden Musikern hatte ich deshalb beim Rudolstadt Festival 2019, bei dem Iran der Länderschwerpunkt war und zu dem auch ich mit Banu eingeladen war. An den Kolleginnen und Kollegen im Iran bewundere ich sehr, mit welcher Ausdauer und Energie sie es schaffen, sich immer wieder neu auf sich häufig verändernde Regeln einzustellen und ihre künstlerische Arbeit fortzuführen. Wie kann man sich ein Coaching bei Dir vorstellen?
Wie kann man sich ein Coaching bei Dir vorstellen?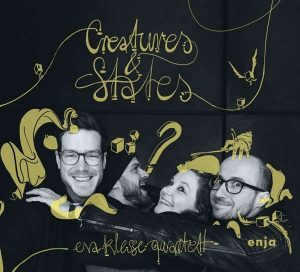 Bei Euren Stücken kommt es öfter vor, dass Ihr Euch eine Geschichte ausdenkt, die Ihr dann in Musik wiedergebt. Wie gehst du beim Komponieren vor und was inspiriert Dich?
Bei Euren Stücken kommt es öfter vor, dass Ihr Euch eine Geschichte ausdenkt, die Ihr dann in Musik wiedergebt. Wie gehst du beim Komponieren vor und was inspiriert Dich? Dass ich die erste Instrumentalprofessorin im Jazz in Deutschland bin, steht natürlich für etwas – aus meiner Sicht hoffentlich für einen Aufbruch in Richtung von mehr Diversität, auch in der Jazzausbildung. In meiner alltäglichen Arbeit an der Hochschule spielt dieser Fakt allerdings keine große Rolle, da ist es mir einfach eine riesige Freude, mit jungen motivierten Musiker*innen zu arbeiten, sie auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen, neue Musik kennenzulernen, sich gegenseitig zu inspirieren und etwas zurück- und weiterzugeben von dem, was ich von meinen Lehrer*innen und Mentor*innen gelernt und mit auf den Weg gegeben bekommen habe.
Dass ich die erste Instrumentalprofessorin im Jazz in Deutschland bin, steht natürlich für etwas – aus meiner Sicht hoffentlich für einen Aufbruch in Richtung von mehr Diversität, auch in der Jazzausbildung. In meiner alltäglichen Arbeit an der Hochschule spielt dieser Fakt allerdings keine große Rolle, da ist es mir einfach eine riesige Freude, mit jungen motivierten Musiker*innen zu arbeiten, sie auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen, neue Musik kennenzulernen, sich gegenseitig zu inspirieren und etwas zurück- und weiterzugeben von dem, was ich von meinen Lehrer*innen und Mentor*innen gelernt und mit auf den Weg gegeben bekommen habe.

 CD „Marble“ (VÖ: 24.04.2020), erhältlich beim Label
CD „Marble“ (VÖ: 24.04.2020), erhältlich beim Label 
 The central theme of your new songs is the loss of a first love and the energy of a new beginning, a really personal matter. Was ist helpful to write about it to become aware of what’s going on?
The central theme of your new songs is the loss of a first love and the energy of a new beginning, a really personal matter. Was ist helpful to write about it to become aware of what’s going on? Wo schreibst du am liebsten deine Lieder?
Wo schreibst du am liebsten deine Lieder? Ist da etwas Neues/Anderes auf deiner kommenden EP „Wisdom Teeth“, im Vergleich zu deinen Liedern, die du davor veröffentlicht hast? Warum sollten wir gespannt sein, sie zu hören?
Ist da etwas Neues/Anderes auf deiner kommenden EP „Wisdom Teeth“, im Vergleich zu deinen Liedern, die du davor veröffentlicht hast? Warum sollten wir gespannt sein, sie zu hören?











 Begonnen hat Deine Musikkarriere mit der Gruppe „Schürmüli Musig“, in der Du mit Deinen Eltern und weiteren Musikern gespielt hast. Wie muss man sich das vorstellen, eine Art kleine „Kelly Family“?
Begonnen hat Deine Musikkarriere mit der Gruppe „Schürmüli Musig“, in der Du mit Deinen Eltern und weiteren Musikern gespielt hast. Wie muss man sich das vorstellen, eine Art kleine „Kelly Family“?

 Du hast ja eine ganz neue Spieltechnik für das Hackbrett entwickelt, ausgehend von der Vibraphontechnik. Das hat Dir den Titel „die Hackbrett-Revolutionärin“ (FAZ) eingebracht. Wie kam es dazu?
Du hast ja eine ganz neue Spieltechnik für das Hackbrett entwickelt, ausgehend von der Vibraphontechnik. Das hat Dir den Titel „die Hackbrett-Revolutionärin“ (FAZ) eingebracht. Wie kam es dazu?
 Jetzt aber zu Deiner neuen CD „Falter“, Deinem ersten Soloalbum, das im letzten Herbst erschienen ist. Was hat Dich zu dem Titel inspiriert?
Jetzt aber zu Deiner neuen CD „Falter“, Deinem ersten Soloalbum, das im letzten Herbst erschienen ist. Was hat Dich zu dem Titel inspiriert?